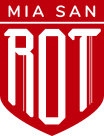FC Bayern und die Schiedsrichter: Eine Ode an den Mann in Schwarz!
Ein Kommentar
Im Fußball strebt man immer mehr nach Perfektion. In einer Sportart, in der alles bis auf das kleinste Detail analysiert und in Statistiken erfasst wird, können Zentimeter über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ein etwas zu langer Pass, eine falsche Fußstellung oder ein um wenige Millimeter zu tief stehender Abwehrspieler: Details entscheiden über Titel, Auf- und Abstiege und im schlimmsten Fall über Existenzen, wenn der bereits einkalkulierte Millionengewinn eben doch nicht zustande kommt.
Angesichts dieser Dimensionen muss man sich schon die Frage stellen, warum es immer noch Leute gibt, die freiwillig den Beruf des Schiedsrichters ausüben. Denn als Spielleiter hat man per Definition keinen leichten Job: Jede Entscheidung wird auf die Goldwaage gelegt, fehlerlose Spiele dagegen nicht thematisiert, sondern totgeschwiegen.
- Warum Nico Schlotterbeck zum FC Bayern passt
- FC Bayern gewinnt in Köln
- Podcast-Folge über den FC Bayern
Und dabei ist der Druck immens: In Sekundenbruchteilen muss der Mann an der Pfeife Entscheidungen treffen, vor einem Millionenpublikum am TV und zigtausend im Stadion. In der Fußball-Bundesliga gibt es in der Saison 2025/2026 insgesamt 23 Schiedsrichter.
Der DFB setzt in der Eliteliga ausnahmslos Männer ein und jeder von Ihnen hat für den Nachweis der Bundesliga-Tauglichkeit ein Stahlbad durchlaufen: Belastungstests, Regelkunde, Leistungsdruck schon in den unteren Ligen, denn nur so macht man heutzutage Karriere.
Schiedsrichter? Ein undankbarer Job!
Oder eben nicht. Denn wer nicht gut kann mit seinem Vorgesetzten, wem es an Vitamin B fehlt, dem wird der Aufstieg in die nächst höhere Liga auch schon mal verwehrt. Und das alles parallel zum normalen Job als Zahnarzt, Bankkaufmann oder Polizist.
KEINEN ARTIKEL MEHR VERPASSEN – JETZT UNSEREN WHATSAPP-KANAL ABONNIEREN!
In diesem Kosmos von Macht, falschen Hoffnungen und dem Streben nach Anerkennung erhalten Schiedsrichter durch die zunehmende Kommerzialisierung des Sports eine immer größere Bedeutung (siehe oben). Waren die Schiedsrichter früher, in Zeiten wo es maximal zwei Kameraperspektiven am TV gab, noch Respektpersonen schwindet die Achtung vom „schwarzen Mann“ mit jeder öffentlich geführten Diskussion um einen angeblich falschen Pfiff.
Der Fußball hat heutzutage so eine große Aufmerksamkeit erreicht, dass es eigentlich unfair ist, die Entscheidung über Sieg oder Niederlage einem einzelnen Mann im Mittelkreis anzuvertrauen. Und seien wir mal ehrlich: Robert Hoyzer hat dem Schiedsrichterwesen 2004 auch keinen Gefallen getan, denn seit dem aufgedeckten Wettskandal vermutet jeder Fußballfan gleich einen handfesten Betrug, wenn der Schiedsrichter mal etwas falsch sieht.
Der VAR entmachtet den Schiedsrichter
Die Einführung des VAR sollte den Schiedsrichter entlasten. Die Technologie sollte ihm helfen, Entscheidungen fair zu treffen. Doch eigentlich ist das Gegenteil eingetreten. Die Schiedsrichter verlassen sich zu sehr auf den Mann am Monitor und treffen nicht mehr selbst die Entscheidung. Und da auch im Kölner Keller Menschen sitzen, die ähnliche Szenen teilweise unterschiedlich interpretieren, kann eine vollkommene Fairness nie erreicht werden.
Die Folge: Aus dem Spielleiter ist mit der Zeit ein verunsicherter Mann geworden, der jetzt per Stadionmikrofon nur noch das durchsagen darf, was ihm ein anderer ins Ohr flüstert.
Zugegeben, das ist arg überspitzt formuliert. Die Wahrheit ist aber: Der Schiedsrichter hat es mit dem VAR nicht leichter und die ständigen Regeländerungen helfen dabei nicht. Wer kann denn heute nicht unfallfrei erklären, wann ein Handspiel zu ahnden ist und wann nicht?
So ist es also kein Zufall, dass Woche für Woche über die Fehlentscheidungen der Schiedsrichter gesprochen wird. Der DFB ist bemüht um Aufklärung und Kommunikation, doch die Kuh bekommt er nicht mehr vom Eis. Der FC Bayern hat im DFB-Pokalspiel von einer Fehlentscheidung profitiert, als Schiedsrichter Tobias Welz eine Abseitsstellung von Luis Díaz vor dem 1:1 übersah.
Der Kicker zählt zudem auf, dass ein Handspiel von Olise im Strafraum nicht erkannt wurde. Das Resultat: Note 6. Eine Watschn für einen Mann, ohne den es dieses Fußballspiel nicht gegeben hätte. Eine Ohrfeige für Jemanden, der sich seit Jahren in den Dienst des Fußballs stellt.
Fehlertoleranz würde dem Fußball guttun!
Klar, Fehler sind nicht schön und für die Kölner war diese Entscheidung genauso schwer zu verstehen wie manche Entscheidungen gegen den FC Bayern in Spielen mit Beteiligung von Real Madrid und dem VAR. Doch ganz ehrlich: Wer würde denn mit Welz und Co. tauschen wollen? Wer würde eine Rolle einnehmen wollen, bei der man nur verlieren kann? Wer würde sich ins Rampenlicht stellen, um sich danach von Fans von Verein A oder wahlweise B beschimpfen zu lassen? Ich nicht.
Die Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga machen mit Sicherheit nicht alles richtig. Aber sie haben auch nicht immer das richtige Werkzeug zur Hand. Beim Pokalsieg in Köln gab es keinen VAR, niemand konnte Welz und sein Team korrigieren. Dass der Video-Schiedsrichter erst ab dem Achtelfinale eingesetzt wird, sorgte schon länger für Diskussionen.
Aber der VAR generell gehört optimiert, die Kommunikation zwischen dem Kölner Keller und dem Platz ist nicht ideal, die Checks dauern zu lange. Und auch die Handspiel-Regel sollte klarer gemacht werden. Die Schiedsrichter sind nicht für die Regeln zuständig, sie setzen sie nur um. Oder versuchen es. Es gibt Abende, da gelingt es besser und Spiele, da gelingt es nicht so gut. Wir sollten das akzeptieren, so wie wir es auch bei den Fußballern tun.
Hier weiterlesen