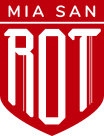Uli Hoeneß über das „Zuschussgeschäft“ Frauenfußball – eine kritische Auseinandersetzung
Wenn Uli Hoeneß ein Interview gibt, explodiert das deutsche Internet für ein paar Tage. Vor allem dann, wenn es ein Podcast ist. Weil es im oft eher dürftig bezahlten Onlinejournalismus nur wenige Leute gibt, die Kapazität und Lust darauf haben, sich ein ganzen Gespräch anzuhören, werden im ersten Schritt die Aussagen verbreitet, die vom entsprechenden Podcast selbst an die entsprechenden Medien weitergeschickt wurden.
KEINEN ARTIKEL MEHR VERPASSEN – JETZT UNSEREN WHATSAPP-KANAL ABONNIEREN!
Nach und nach hören dann aber doch mehr Leute rein und so gibt es über Tage hinweg meist immer wieder neue Aussagen, die das Licht der noch breiteren Öffentlichkeit erblicken. Daran lässt sich einiges ableiten. Vor allem aber wohl, dass Hoeneß nach wie vor der Name im deutschen Fußball ist, der am meisten zieht.
Egal, was der Patriarch des FC Bayern zu sagen hat, es hat Gewicht. Diesmal hat er sich im „OMR-Podcast“ ca. 100 Minuten lang über verschiedene Themen geäußert. Ob es wohl auch breit angelegte News über seine Aussagen zum Fußball der Frauen geben wird? Vermutlich nicht viele. Dabei ist eine Auseinandersetzung damit wichtig.
Wir haben deshalb nicht nur die Aussagen, sondern kommentieren diese auch, um die Debatte rund um das Thema nicht verstummen zu lassen.
- FCB Frauen drehen Rückstand gegen Hoffenheim
- FC Bayern vor Stadionkauf in Unterhaching: Die perfekte Lösung?
- Vor Duell mit Arsenal: FC Bayern überrollt den SC Freiburg
Uli Hoeneß äußert sich zu den FC Bayern Frauen und zum Frauenfußball insgesamt
Darauf angesprochen, ob in der Frauenabteilung nennenswertes Umsatzwachstum zu erwarten sei, sagte Hoeneß: „Nein, vorerst nicht. Ich meine, so toll das ist, ich bin ein großer Freund des Frauenfußballs, unsere Mannschaft spielt heute auch einen sehr gepflegten Fußball. Vor vielen Jahren habe ich das ein bisschen anders gesehen, aber man muss sich im Klaren sein, dass das vom Wirtschaftlichen her immer noch ein Zuschussgeschäft ist.“
Das Team koste „den FC Bayern etwa sechs bis acht Millionen Euro pro Jahr und es ist nach wie vor so, dass die Vermarktung dieser Mannschaft noch nicht sehr professionell ist, daran muss gearbeitet werden. Da muss auch die Damenabteilung in unserem Verein noch ein bisschen zulegen.“
Es könne „nicht immer sein, dass nur die Männer das subventionieren. Auf die Dauer müssen die sich selbst tragen und diese Mär von Equal pay, die halte ich für einen totalen Schwachsinn. Ich bin immer dafür, dass jeder das verdient, was er einspielt. Und wenn die Frauen irgendwann 10 Millionen Euro einspielen, können sie auch 10 Millionen Euro verdienen. Und solange das nicht der Fall ist, müssen sie kleinere Brötchen backen“.
„Zuschussgeschäft“ FC Bayern Frauen: Hoeneß hat einen Punkt, aber verkürzt den Kontext
Aussagen, die in der Frauenabteilung selbst für Irritation sorgen müssen. Denn einerseits benennt Hoeneß natürlich Fakten:
- Die Frauenabteilung des FC Bayern ist de facto ein Zuschussgeschäft
- Das Marketing der Frauenabteilung ist objektiv betrachtet nicht gut genug
- Equal pay ist tatsächlich eine Mär (aber anders, als es Hoeneß meint)
Doch Schritt für Schritt und jeder dieser Punkte nacheinander. Dass die Frauenabteilung ein Zuschussgeschäft ist, hat mehrere Gründe. Zunächst mal sind da historische Aspekte anzuführen. Es ist unmöglich, den Status-quo als solchen zu betrachten und nach heutigen Standards zu bewerten, ohne das über ein Jahrhundert lang stattfindende Abhängigkeits- und Unterdrückungsverhältnis zu benennen.
Hoeneß sagt an späterer Stelle noch, dass er vor drei, vier Jahren nicht geglaubt hätte, dass Spiele von Frauenteam in Europa vor 40.000 oder 50.000 Zuschauer*innen stattfinden würden. Bei der zweiten inoffiziellen WM 1971 in Mexiko erreichte Dänemark das Finale gegen Gastgeber Mexiko. Im Aztekenstadion waren damals 110.000 Zuschauer*innen mit dabei.
In der Dokumentation „Copa 71“ sprach die englische Spielführerin Carol Wilson von einem „Sprung in ein Paralleluniversum“. Zu Hause waren sie es gewohnt, behindert, übersehen und verspottet zu werden. Sie spielten auf Parkplätzen vor einer Hand voll Zuschauer*innen. „Sobald wir aus dem Flugzeug stiegen, wurden wir von Blitzlichtern geblendet“, erinnerte sich Wilson: „Und das hörte in den ganzen fünf Wochen, die wir dort waren, nicht auf.“
England zeigt, welches Potenzial der Frauenfußball hatte
Anderer Kontinent, andere Kulturen? Anfang der 1920er Jahre zogen britische Frauenfußballteams zehntausende Zuschauer*innen in die Stadien. Im Goodison Park, einem Stadion in Liverpool, standen die Menschen dicht an dicht, bis 53.000 von ihnen auf den Tribünen waren. Das Stadion war komplett überfüllt, weitere 10.000 mussten nach Hause geschickt werden. Sie kamen nicht etwa für ein Spiel der Männer.
Die Dick, Kerr Ladies gewannen mit 4:0 gegen die St Helens Ladies. Sie waren damit nicht allein. Der Fußball der Frauen erlebte damals einen Boom. Unter anderem spielten einige dieser Teams während der Kriegszeit zuvor Benefizspiele, in denen Geld für verletzte Soldaten gesammelt wurde. Es war eine Zeit, in der sich viele Frauenteams auf der Insel gründeten.
Für die FA war das offenbar ein Affront. Denn bereits 1922 entschied sich der englische Verband dazu, die Austragung von Frauenfußballspielen auf den Plätzen ihrer Mitglieder zu verbieten. Die offizielle Begründung: Frauen wären physisch nicht für den Fußball geeignet und das würde ihre Fruchtbarkeit gefährden. Tatsächlich aber fürchtete man den Frauenfußball als ernsthafte Konkurrenz für den Männerfußball.
Der Frauenfußball ist abhängig von den Strukturen der Männer
Ähnliche Geschichten gibt es auch in Deutschland und anderen Ländern der Welt. Über viele Jahrzehnte wurde die Entwicklung des Frauenfußballs nicht einfach nur angehalten, sondern er wurde aktiv unterdrückt, klein gehalten und in der Gesellschaft mit Desinformation und Spott ins Lächerliche gezogen.
Selbst als der DFB, der seinen Vereinen 1955 verboten hatte, Frauen zu trainieren und sie spielen zu lassen, 1970 sein Verbot wieder aufhob, gab es zunächst keine echte Integration. Stattdessen ging es weiter mit angepassten Regeln, gesellschaftlichem Spott und der Blockade einer echten Entwicklung.
Erst in der jüngeren Geschichte des Fußballs gelingt es dem Frauenfußball weltweit vereinzelt, große Schritte in Richtung Gleichstellung zu erzielen. Doch das berühmte Kind ist längst in den Brunnen gefallen: In der von Männern dominierten Welt haben sich Strukturen rund um den Männerfußball gebildet, die sich über viele Jahrzehnte entwickelt haben.
Strukturen, von denen die Frauen heute abhängig sind. Weil sie nie die Chance hatten, sich eigene aufzubauen. Eine Abhängigkeit, die letztlich auch dazu geführt hat, dass eigene Traditionen nach und nach verschwinden. Von den einstigen Topklubs Turbine Potsdam und dem 1. FFC Frankfurt sind nur noch Fragmente übrig. Viele weitere Traditionsklubs sind bereits noch mehr verschwunden oder werden noch verschwinden. Wie sollte eine Alternative ohne diese Strukturen aussehen? Dass Frauen wieder auf Parkplätzen spielen?
Geschichtsvergessene Betrachtung des Fußballs
Mit der Historie des Fußballs müssten viel mehr Bücher gefüllt werden, damit auch Menschen wie Hoeneß zumindest anerkennen, dass es nicht dasselbe ist, ob ein Manager mit wenigen Mitteln in den 1970er Jahren einen Klub an die Spitze führt, oder ob jemand dasselbe mit begrenzten Mitteln im Jahr 2020 oder 2025 versucht.
Während der Fußball der Frauen kleingehalten wurde, wird nun von ihm erwartet, dass er sich eher vorgestern als heute von selbst trägt und eigene Strukturen entwickelt, die bei den Männern viele Jahrzehnte gebraucht haben. In einer Welt, die durch das wirtschaftliche System längst schon so vorangeschritten ist, dass Investoren im Ausland beispielsweise weniger beim Gedanken daran zögern, ob sie fünf Millionen Euro in ein Frauenteam stecken oder nicht.
Wenn sich also jemand wie Hoeneß vor drei oder vier Jahren nicht vorstellen konnte, dass der Frauenfußball Stadien füllt, dann liegt das vor allem daran, dass die Geschichtsschreibung wie in vielen Fällen eine starke männliche Perspektive hat. Dass viele Geschichten, die der Frauenfußball schon vor Jahrzehnten schrieb, in Vergessenheit geraten sind, weil sie niemand erzählt hat oder sie von Verbänden aktiv verleumdet wurden.
Es gab dieses Wachstumspotenzial damals und auch heute ist es noch da. Wenngleich sich freilich darüber streiten lässt, wie groß das Potenzial im Detail ist.
Der FC Bayern hat kein Prozent des Umsatzes übrig?
Wenn Hoeneß die eigene Frauenabteilung aber vor allem darauf beschränkt, dass sie ein Zuschussgeschäft sei, dann klingt das vor dem Hintergrund der Historie bestenfalls gönnerhaft. Schlimmstenfalls ist es eine Abwertung. Wenngleich er diese wohlwollend interpretiert eher nicht vornehmen wollte.
Für den FC Bayern sind Ausgaben in diesem Bereich Peanuts. Ein einziger durchschnittlicher Spieler im Kader des Rekordmeisters verdient im Jahr in etwa so viel, wie die Frauenabteilung insgesamt offenbar kostet. Acht Millionen Euro sind nicht mal ein Prozent des Umsatzes, die dieser Klub macht.
Was es unter der Prämisse, dass man die Frauenabteilung wirklich nach vorn bringen möchte, wirklich bräuchte, wäre Überzeugung. Fakt ist aber, dass Sportvorstand Max Eberl, der der direkte Vorgesetzte von Bianca Rech als Direktorin der Frauen ist, sich bisher nicht mal nennenswert bei Spielen der Frauen hat blicken lassen. Sein Interesse an diesem Bereich ist geprägt durch sehr wenige leere Phrasen und Abwesenheit. Ob er wohl fünf aktuelle Spielerinnen des Kaders unvorbereitet benennen könnte? Die Wette gilt.
Wachstumsmarkt Frauen wächst nicht von allein
Hoeneß hat nun unterstrichen, dass die Überzeugung nicht da ist. Wirtschaftlich kann man das aus der Jetzt-Perspektive heraus sicherlich verargumentieren. Nur müsste Hoeneß besser als jeder andere wissen, dass es Risiken und Investitionen benötigt, um nachhaltig Schritte nach vorn gehen zu können. Ein Wachstumsmarkt wächst nur, wenn investiert wird. Er wächst nicht von allein.
Zumal das Risiko angesichts der für den FC Bayern kleinen Beträge überschaubar ist. Es ist also gewissermaßen recht engstirnig, zu glauben, das würde jetzt alles schon so laufen. Was Hoeneß nicht sagt, was aber ebenfalls ein gutes Argument seinerseits gewesen wäre: Für ein echtes Wachstum müssen auch andere Player des Marktes mehr Geld in die Hand nehmen. VW oder Eintracht Frankfurt beispielsweise. Der DFB als Verband sowieso. Es bleibt abzuwarten, was die Neustrukturierung in einer Art Frauen-„DFL“ dahingehend bewirken kann.
Vom FC Bayern ist es aber allenfalls naiv, wenn er tatsächlich denkt, dass es möglich sein wird, mit der Frauenabteilung weiter zu wachsen, wenn die Investitionen stagnieren oder sogar zurückgehen sollten. Es wäre auch naiv, zu glauben, dass man auf dieser Grundlage in der Lage sein wird, sich selbst zu tragen.
Der FC Bayern sollte konsequenter handeln
Hoeneß tut so, als wäre der Fußball der Frauen in der Lage, sich einfach so vom Abhängigkeitsverhältnis zu lösen, das er zu den Männern hat. Nach dutzenden Jahren des Aufbaus der wichtigsten Strukturen rund um den Männerfußball. Wie soll das realisierbar sein? Die Konsequenz aus dieser Logik wäre entweder, die Frauen gleichwertig partizipieren zu lassen und so auch ein Zeichen zu setzen, das die Marke „Mia san mia“ stärken würde. Sie mit maximal 1-2 Prozent des Umsatzes so zu fördern, wie es ihren Leistungen der letzten Jahren gerecht wäre.
Oder eben die Spielchen zu beenden und die Frauenabteilung endgültig sich zu überlassen, weil sie wirtschaftlich nicht tragfähig ist und der Multimillionenkonzern es nicht für profitabel hält. Und weil man nicht daran glaubt, dass es sich hier tatsächlich um einen Markt hält, der bald rapide wachsen könnte. Tatsächlich befindet man sich derzeit genau dazwischen. Es wird von Entwicklungen fabuliert, aber nicht entsprechend gehandelt. Ehrlich ist das nicht.
Vielleicht liegt Hoeneß mit seiner wirtschaftlichen Prognose auch richtig. Vor allem dann, wenn sich noch mehr Klubs dazu entscheiden sollten, die Investitionen einzustellen oder stagnieren zu lassen, wird es sicherlich schwieriger mit dem Wachstum. Bisher sind solche Entwicklungen unter den Top-Nationen aber nur in Deutschland zu erkennen.
Das wird zwangsweise dazu führen, dass andere Nationen ihren Vorsprung ausbauen, wenn hierzulande noch länger darüber nachgedacht wird, ob eine (weitere) Umverteilung der Budgets sinnvoll wäre oder nicht. Der FC Barcelona und auch der FC Arsenal generierten laut Deloitte Umsätze von knapp 18 Millionen Euro. Chelsea (13,4 Millionen Euro) und Manchester United (10,7 Mio. Euro) folgten. Barça lag vor zwei Jahren noch bei 7,7 Millionen Euro, United bei 6 Millionen Euro.
Bayerns Marketingproblem
Das führt aber auch zu einem weiteren Punkt, den Hoeneß anspricht: Marketing. Wenn er kritisiert, dass die Frauenabteilung nicht ausreichend vermarktet werde, ist das ein Kritikpunkt, der sehr legitim ist. Tatsächlich ist das Marketing rund um die Highlightspiele in den meisten Fällen sehr dünn gewesen. In der Stadt gab es rund um das Arsenal-Spiel vor einigen Tagen kaum ernsthafte Werbung.
Auch auf den Social-Media-Kanälen gab es zu wenig Aufmerksamkeit – vor allem auf denen der Männer. Andere Klubs haben das in den vergangenen Jahren deutlich besser hinbekommen, sich immer mehr zu Leuchttürmen des Frauensports entwickelt. Bei den Frauen der Bayern ist es schon länger so, dass es nicht gelingt, das Team in Deutschland und in Europa noch größer, noch bekannter und noch attraktiver zu machen.
Zugegeben: Von der Couch oder dem Bürostuhl aus lässt sich das leicht schreiben. Gleichzeitig sollte diese Kritik aber nicht (ausschließlich) in Richtung derer gehen, die aktuell verantwortlich sind. Wer auch nur rudimentär Einblicke in die alltägliche Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frauenabteilung bekommt, weiß, dass da 24/7 daran gearbeitet wird. Auch hier ist es aber eine Frage des Budgets.
Einige wichtige Stellen in der Öffentlichkeitsarbeit sind personell dünn besetzt, manche Jobs, die andere Klubs an externe Dienstleister weitergeben, werden beim FCB von Leuten geschultert, die noch in drei anderen Bereichen einen Berg voller Aufgaben haben. Wie soll unter diesen Voraussetzungen ein Marketing funktionieren, das den Ansprüchen gerecht wird? Wenn Hoeneß also sagt, dass die Frauenabteilung noch „ein bisschen zulegen“ müsse, dann sollte er auch das entsprechende Budget dafür freigeben. Oder eben feststellen, dass viel mehr nicht möglich ist.
„Equal pay“ ist als Nebelkerze langsam ausgelutscht
Und dann ist da noch die Nebelkerze „Equal pay“, die Hoeneß gezündet hat. Eine, die sehr populistisch ist – ob nun gewollt oder nicht. Der Begriff „Equal pay“ wurde schon vor vielen Jahren von nahezu allen Spielerinnen und Verantwortlichen entkräftet. Denn den allermeisten von ihnen geht es nicht darum, zehn Millionen Euro im Jahr zu verdienen.
Es geht um die weiter oben beschriebene Teilnahme an den Strukturen, die der Männerfußball gebildet hat. Darum, einer Gleichstellung in den Bedingungen näher zu kommen. Es geht nicht um Millionenbeträge auf dem Gehaltscheck. Sicherlich geht es schon auch darum, dass Profifußballerinnen ausreichend verdienen sollten, um davon leben zu können. Dass sie nicht noch drei Jobs nebenher erledigen müssen und zugleich die Anforderungen von Leistungssport stemmen müssen.
Aber das ist zumindest beim FC Bayern schon länger kein Thema mehr. Die Probleme in München scheinen eher darin zu liegen, wie viel Anteile an für die Männer alltäglichen Strukturen man den Frauen tatsächlich gewähren möchte. Und ob man mit den nächsten zehn Millionen Euro lieber ernsthaft in die Zukunft der Frauenabteilung investiert, oder doch in einen Rotationsspieler für die erste Männermannschaft.
Auch Bianca Rech kann mehr Druck aufbauen
Klar ist aber auch, dass das Thema komplexer ist als eine Einbahnstraße. Es ist auch die Verantwortung von Bianca Rech, um entsprechende Budgets zu kämpfen und mit inhaltlichen Argumenten zu überzeugen. Das mag unter dem Umstand, dass ihr Vorgesetzter (Eberl) nicht allzu viel Interesse daran zeigt, nicht leicht sein.
In der Vergangenheit bemühte sie sich in der Außendarstellung stets darum, die Harmonie zu wahren. Zwischenmenschlich und für ihr eigenes Wohl nachvollziehbar. Vielleicht muss irgendwann aber auch der Punkt kommen, an dem hier und da eine kantigere Aussage getroffen wird, wenn es intern in den Verhandlungen nicht weitergeht. Es ist nicht so, dass Rech gar keine Druckmittel und Möglichkeiten hätte, um eine Budgeterhöhung zu erkämpfen.
Zwar mag es richtig sein, dass der FC Bayern in den letzten Jahren insgesamt auf einem guten Weg ist. Auch der Kauf des Sportparks in Unterhaching könnte ein weiterer wichtiger Schritt für die Frauen sein. Und doch deutet gerade vieles auf finanzielle Stagnation hin. In einer Zeit, in der andere Topklubs viel investieren. Das ist gefährlich.
Video: Unsere Analyse des Geschäftsjahres im XXL-Podcast
Hoeneß kritisiert die Medien
Und auch wenn diese Auseinandersetzung eigentlich schon vor zehn Absätzen zu lang wurde für einen normalen Artikel, ist da noch ein weiterer Punkt, der mich als Chefredakteur von Miasanrot besonders irritiert hat. Hoeneß sagte im Podcast: „In Deutschland gibt es ein großes Problem: Das Interesse am Fußball ist riesig groß.“
Und weiter: „Die Medien, die Fernsehanstalten tun so, als wenn es kein Morgen gäbe, aber bei uns ist es nach wie vor so, dass unsere überragende Frauenfußballmannschaft im Stadion am Campus am Wochenende, wenn Bundesliga stattfindet, vor 2.500 Zuschauern spielt. Und die Leute, die immer erzählen: Ja, aber man muss Frauenfußball pushen, man muss Frauenfußball noch mehr in den Vordergrund stellen, die sollen selber mal hingehen. Das sind meistens die, die gar nicht hingehen und immer viel erzählen.“
Nun müssen wir uns diesen Schuh sicherlich nicht anziehen. Aber als Medium, das fast bei jedem Heimspiel vor Ort war und zuletzt auch mit nach Paris oder Nürnberg gereist ist, können wir zumindest festhalten: Der Ertrag ist oftmals ernüchternd. Manchmal hängt das auch mit der generellen Rechtelage zusammen, wenn beispielsweise in bestimmten Bereichen nicht gefilmt oder fotografiert werden darf. Dafür kann der FC Bayern nichts.
Wie erhöht man die Attraktivität für die Medien?
Aber wenn wir zweimal einen Reporter zu Auswärtsspielen in Nürnberg und Paris schicken und letztendlich kein einziges Kurzinterview mit einer Spielerin führen konnten, dann ist das bitter. In Paris kamen organisatorische Schwierigkeiten hinzu, für die der FC Bayern wenig konnte. Immerhin schickte man uns noch den Trainer zum Interview und ein paar Audiodateien.
Es geht an dieser Stelle auch nicht darum, die Presseverantwortlichen der Frauenabteilung über Gebühr zu kritisieren, der Austausch und die Kommunikation sind insgesamt gut. Es geht eher um die Frage, warum sich Medien aktuell dazu entscheiden sollten, ein Spiel der Bayern Frauen zu besuchen und wo die konkreten Erträge liegen. Ob wir nochmal eine Champions-League-Auswärtsreise finanzieren, ist jedenfalls unklar.
Auch und gerade hier muss man sich in München dann vielleicht die Frage stellen, wo es Verbesserungspotenziale gibt, um die Besuche für Medien attraktiver zu gestalten. Hoeneß nutzt in diesem Argument wieder eine Nebelkerze. Er hat zwar Recht, dass es bei den meisten großen und bekannten Medien allenfalls ein Lippenbekenntnis zum Frauenfußball gibt. Die Berichterstattung ist meist oberflächlich und auf Superlative fokussiert. Geschichten werden kaum hintergründig erzählt und wertig aufbereitet. Das stimmt.
Aber vielleicht sollte man sich als Verein dann auch bewusst für jene Medien weiter öffnen und deren Arbeit belohnen, die an hintergründiger Arbeit interessiert sind. Und da geht es jetzt nicht nur um Miasanrot, sondern auch um andere Medien, die oft da sind und sich deutlich mehr bemühen als die, gegen die Hoeneß paradoxerweise gern verbal ausholt, um sie im nächsten Zug dann doch wieder bewusst zu füttern.
Es ist eine verzwickte Lage im Frauenfußball. Mit verkürzten Argumenten und fehlendem Willen für echte Fortschritte wird das noch eine Weile so bleiben. Bestenfalls.
Hier weiterlesen